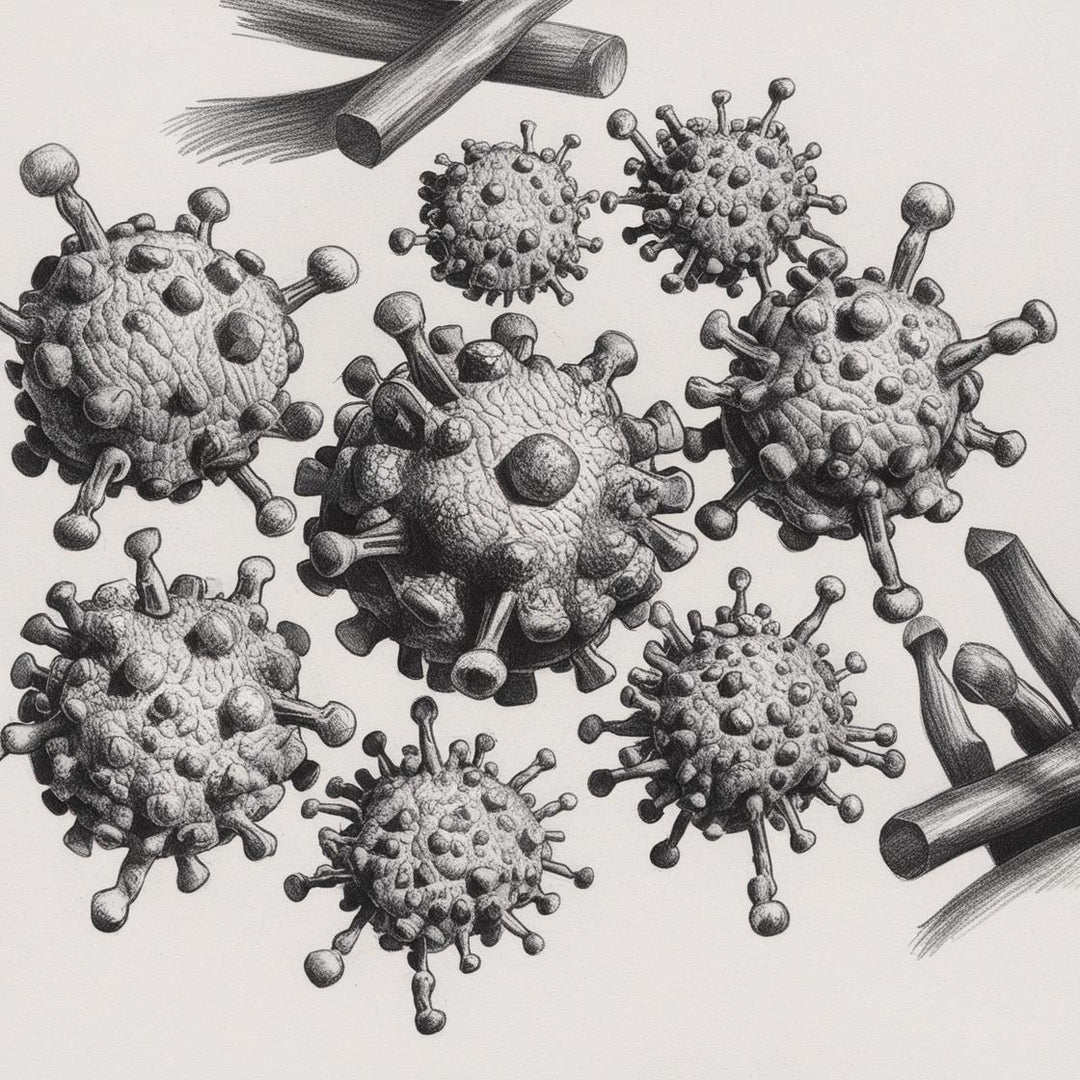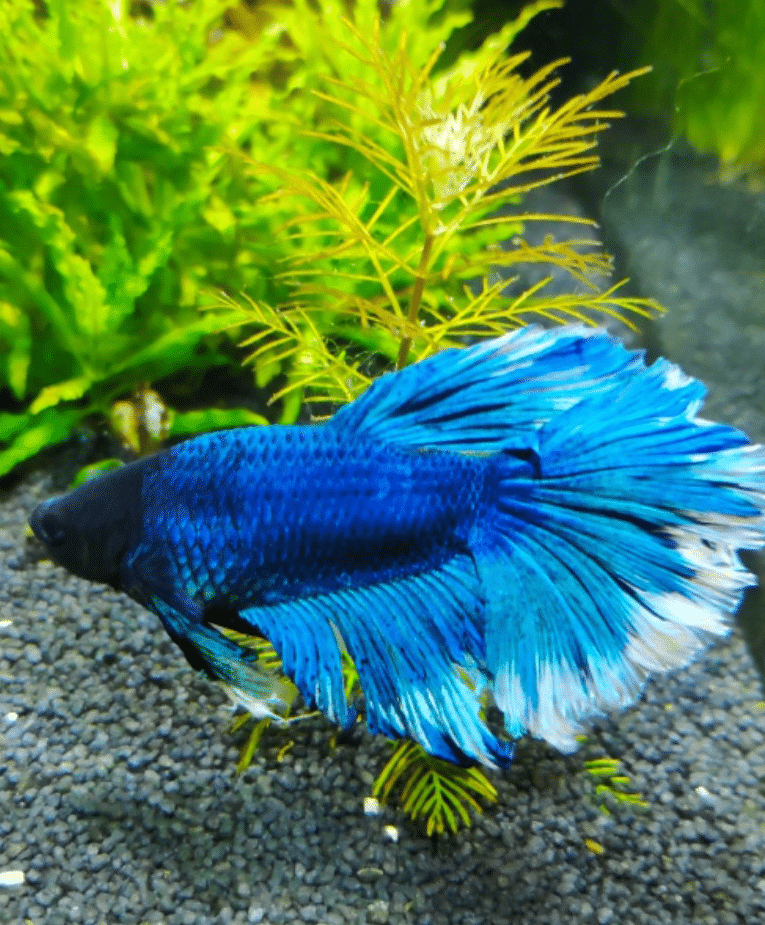Alternative Leistungsförderer sollen auf den Organismus einen positiven Einfluss hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Gesundheit nehmen. Zu den Leistungsförderern werden Probiotika, Präbiotika, Enzyme, organische Säuren/Salze und ätherische Kräuter hinzugezogen. Sie lassen sich unter den Zusatzkategorien sensorischer und zootechnischer Zusatzstoffe wiederfinden (VERORDNUNG (EG) Nr. 1831/2003) [7].
Sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe
Sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe nutzen die gesundheitsfördernden, parasitenhemmenden, entzündungshemmenden oder antibakteriellen Eigenschaften von Heilpflanzen zur Bekämpfung von Gesundheitsproblemen. Laut Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 werden diese in den Kategorien sensorischer und/oder zootechnischer Zusatzstoffe eingeordnet. Die rechtliche Differenzierung zwischen Phytotherapeutikum und Futterzusatzstoff (Phytoadditiv) ist als schwierig zu betrachten.
Phytotherapeutika sind Arzneimittel, deren Herstellung aus ganzen Pflanzen oder Pflanzenextrakten erfolgt [1]. Da Phytotherapeutika aus den gleichen Bestandteilen wie ein Phytoadditiv (unterliegt nur der Verordnung (EG) 1831/2003) bestehen, ist hier das Problem, dass diese dem Arzneimittelgesetz unterliegen.
Um die Problematik zu umgehen, stellt die Unterteilung nach der Einsatzmenge einen Ansatz dar. Hierbei werden Phytoadditive in ernährungsphysiologisch bedeutenden Mengen aufgenommen. Zu den häufigsten sekundären Pflanzenstoffe zählen die Gruppen der Bitterstoffe, der Scharfstoffe, ätherische Öle, phenolische Öle, Saponine, Alkaloide, Glykosinolate, Mucilaginosa und Gerbstoffe [2]. Rein von der chemischen Struktur zeigen die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe eine inhomogene Struktur, denen eine Vielzahl von Wirkungen und Wirkmechanismen zugeschrieben werden kann. Anders als bei konventionellen Arzneimitteln, ist die Wirkung nicht nur auf einen einzelnen Wirkstoff zurückzuführen, sondern auf die Wechselwirkungen mehrerer beteiligter Substanzen [1]. Sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe haben unterschiedliche Auswirkungen auf den Organismus, die als antiphlogistisch, antiseptisch, antiviral, immunsystemstabilisierend, appetitanregend, antiparasitär beschrieben werden können [3, 4, 5].
In einem 13-wöchigen Fütterungsversuch von Nil-Tilapia (Oreochromis Niloticus) mit Oregano (Origanum vulgare) führte eine Oreganokonzentration von 1 % zu einer signifikanten Verbesserung der täglichen Zunahme, der relativen und spezifischen Wachstumsrate und der Futterverwertung [6].
Wissenschaftliche Quellen:
[1] Striezel, A. (2005): Leitfaden zur Nutztiergesundheit: ganzheitliche Prophylaxe und Therapie. 1. Aufl., MVS Medizinverlag, Stuttgart, S. 30.
[2] Wenk, C. (2003): Growth promoter alternatives after the ban on antibiotics. In: Pig News and Information 24 (1), S. 11 – 16.
[3] Wetscherek W. (2002): Phytogene Futterzusatzstoffe für Schweine und Geflügel Tagungsband: 1. BOKU – Symposium Tierernährung, 05.12.2002, Wien. S. 18 – 23.
[4] Jones, G. (2001): High-performing livestock and consumer protection are not contradictory, impact of a phytogenic additive. In: Feed Magazine 12, S. 468 – 473.
[5] Schlicher H. (1986): Pharmakologie und Toxikologie ätherischer Öle. In: Therapiewoche 36, S. 1100 – 1112.
[6] Seden, M. E. A; Abbass, F. E.; Ahmed, M. H. (2014): Effect of origanum vulgare as a feed additive on growth performance, feed utilization and whole body composition of nile tilapia, Oreochromls niloticus. fingerlinges challenged with pathogenic Aeromonas hydrophila. In: AGRIS Science 34, S. 1683 – 1695.
[7] VERORDNUNG (EG) Nr. 1831/2003 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 22. September 2003 über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung.